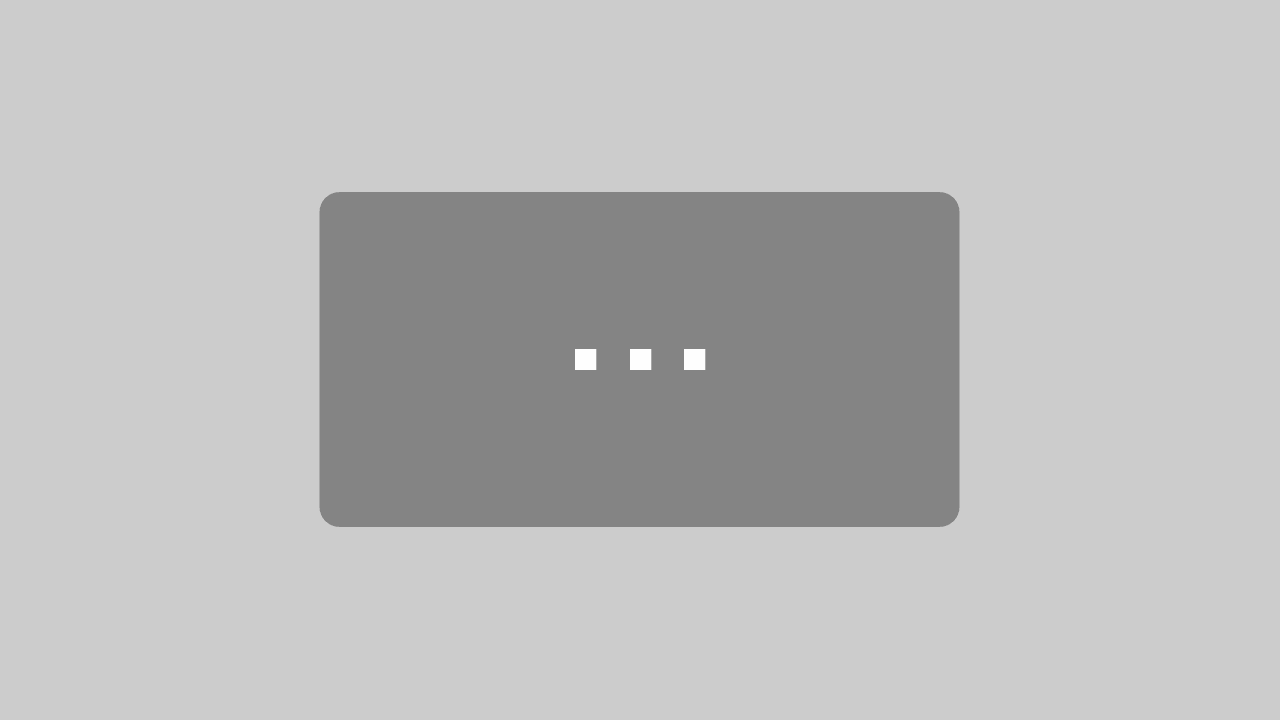Man kann eine Künstlerin aus Schweden holen. Aber man kann Schweden nicht aus einer Künstlerin holen. Der lebende, atmende, singende Beweis dieser These ist Emma Elisabeth Dittrich, eine in Berlin sesshaft gewordene Exilantin, die in ihren berauschenden Indie-Songs den Freigeist der Siebziger mit jenem typisch nordischen Sinn für ahnungsvolle Melancholie verbindet.
Sie verbringt ihre Kindheit umgeben von einem Meer aus Instrumenten, sie spielt in zahlreichen Bands, sie studiert Gesan am angesehenen Kulturama in Stockholm. Dann vertraut sie sich der Welt an und wird zur reisenden Nomadin. Sie lebt und musiziert in London, Paris oder den USA, wo sie eingeladen wird, um auf dem prestigeträchtigen SXSW Festival zu spielen. Sie tourt mit einer ihrer Bands sogar durch Japan, ehe sie sich dazu entschließt, mal eine Weile in Berlin zu bleiben. Einfach mal so. „Als wandernde Musikerin musst du nur deine Instrumente in eine Tasche packen und kannst im Grunde von überall arbeiten“, sagt sie. Dass es dann letztlich Berlin wird, ist nur ein weiterer in einer langen Kette von Zufällen, die sich am Ende irgendwie als weise Schachzüge erwiesen haben. „Eines Tages machte man mich mit einem Verleger bekannt. Und der saß nun mal in Berlin.“ Sie zuckt mit den Schultern. „Und was soll ich sagen, ich bin geblieben.“ Wie sagte die Queen doch so schon: Anywhere the wind blows.

Inmitten der siedenden Hauptstadt hat sie sich häuslich eingerichtet, hat sich mit genau den Menschen umgeben, mit denen sie am liebsten arbeitet. „Berlin ist so unsagbar kreativ, international, entspannt und außerdem ziemlich grün. Zudem“, grinst sie, „ist die Stadt im Vergleich zu London immer noch bezahlbar.“ Ob Berlin oder sonstwo: Emma Elisabeth findet überall Inspiration. Ihr eigenes Leben, die Menschen, die sie umkreisen, das Profane und das Magische. Ohne Unterlass schreibt sie Musik, schreibt und schreibt, entwickelt sich weiter, reflektiert, verarbeitet. Sie schreibt ihre eigenen Songs, schreibt für andere, namhafte Künstler*innen, schreibt für Filme. 2016 gab sie mit den wundervollen, bittersüßen Fremdinterpretationen auf „Cover Stories“ einen sehr persönlichen Einblick in ihre musikalische Sozialisation, 2019 zeigte sie mit „Melancholic Milkshake“ ihre Leidenschaft für den gitarrengetriebenen Jangle Pop der Sechziger und Siebziger. Am Ende ist es aber fast egal, was sie macht: Immer ist es gezeichnet von jener brütenden Melancholie der nördlichen Hemisphäre. „Das ist wohl einfach meine schwedische Art“, sagt sie mit einem stillen Lächeln. „Die steckt tief in meinen Knochen. Ich habe mal eine Ausstellung in Schweden besucht, die ‚Scandinavian Pain‘ hieß. Das trifft es, denke ich. Wir sind alle recht anfällig für diese Art von Gefühl.“
Ihr Album „Some Kind Of Paradise“ macht da keine Ausnahme. Im Gegenteil: Obschon es alle Insignien eines zeitlosen Pop-Albums aus der goldenen Ära der Songwriter in sich trägt, strahlt es eine gedankenverlorene, bittersüße, dramatische Grundstimmung ab. „Wir Schweden werden das wohl nie los“, lacht sie. „Ich meine, selbst die meisten ABBA-Songs sind ziemlich melancholisch. Und was soll ich sagen, ich liebe diese Art von Musik einfach. Mir geht es nur darum, meine eigene Farbe zu erkennen und sie von allen möglichen Umgebungen verändern, mischen und prägen zu lassen – schwedische Traurigkeit, gekreuzt mit mallorquinischer Sonne, zum Beispiel.“ Stimmt schon: Die Melancholie verflog selbst nicht, als sie Anfang des Jahres auf einer Farm auf der spanischen Insel an ihren neuen Songs arbeitete. „Deine Musik wird aufgesogen und erstrahlt in völlig anderen Grundierungen“, schwärmt sie.
HIER unsre Review zum Album! Und natürlich die neue Stripped Back Version ihrer Single „You’re Not God“: