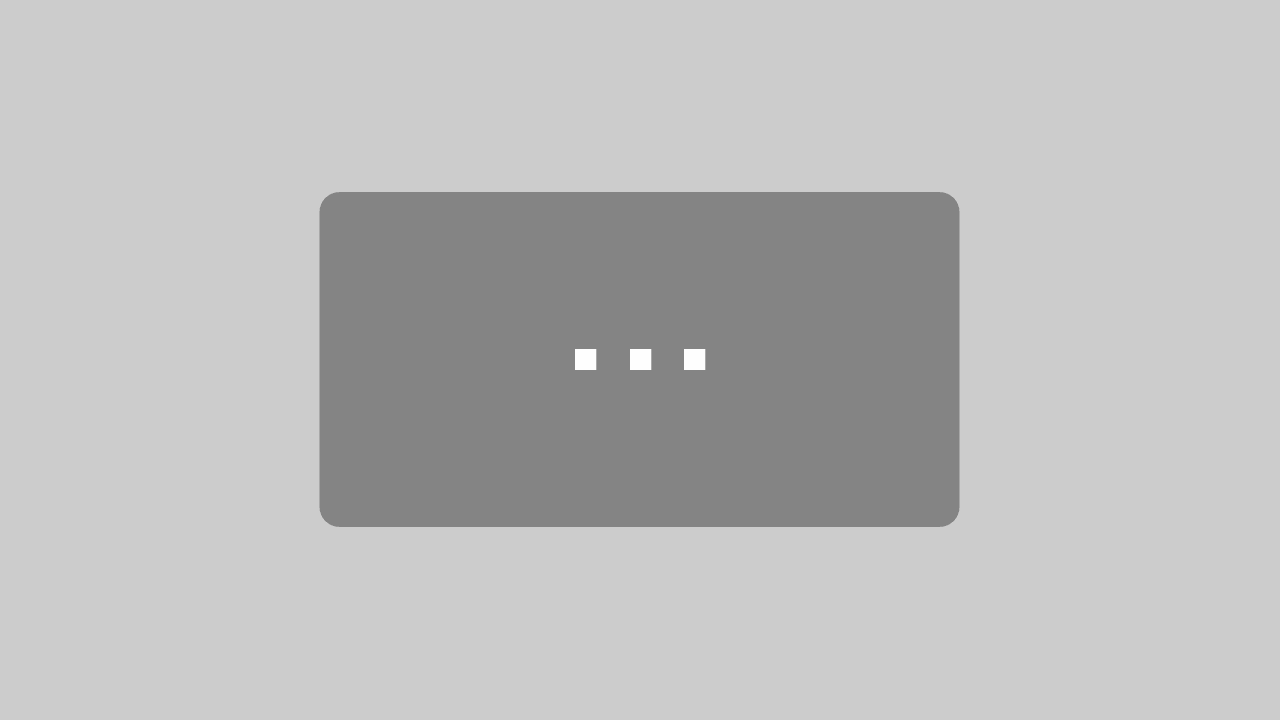MUNA sind magisch. Welche andere Band hätte das verlorene Jahr 2021 mit Pailletten und Pompoms geprägt – und dich dabei ganz nebenbei zum Singen bringen können (und vielleicht sogar zu glauben), dass „Life’s so fun, life’s so fun“ ist? All das während der vielleicht unruhigsten Phase deines Lebens? „Silk Chiffon“, der Instant-Hit von MUNA mit Labelchefin Phoebe Bridgers, schlug wie ein doppelter Regenbogen in den grauen Himmel der anderthalbjährigen Pandemie ein. Pitchfork nannte es einen „Strudel von Schmetterlingen im Bauch“, NPR einen „Queerwurm“, der US-Rolling Stone „eine der süßesten Melodien des Jahres, die die Art von purer Pop-Seligkeit ausstrahlt, die so viele Bands anstreben, aber fast nie richtig hinbekommen.“ Für MUNAs Gitarristin und Produzentin Naomi McPherson war es ein “song for kids to have their first gay kiss to.” Und so blühten mehrere Tausend verrückte Twitter- und TikTok-Memes auf.
Katie Gavin, Sängerin und Songschreiberin von MUNA, schrieb „Silk Chiffon“ direkt nach der Fertigstellung des vorigen Albums „Saves the World“, das die Band im Jahr 2019 veröffentlichte. Das war eine LP, deren Leadsingle mit „So I heard the bad news / Nobody likes me and I’m gonna die alone in my bedroom / Looking at strangers on my telephone“ begann und mit einem hypnotischen, selbstforschenden Bekenntnis übers Scheitern und den Trost endete.
Seit Beginn ihrer Karriere haben MUNA den Schmerz als Fundament der Sehnsucht, als Zentrum der radikalen Wahrheit, als Teil des Erwachsenwerdens und als inhärenten Faktor der Erfahrung von Marginalität betrachtet – die Bandmitglieder gehören Queer- und Minderheitengemeinschaften an und spielen ihre Songs vor allem für diese. Aber in „Silk Chiffon“ gab es nur Sehnsucht, und diese wurde glücklicherweise auch erwidert. “It’s kind of a smooth-brain song”, sagt Gavin. “Saves the World was therapy on a record, and I was starting to see changes in my life, more moments of joy. It’s a big deal that someone like me could write that smooth!” Was den Konfetti-Refrain von „Silk Chiffon“ jedoch so stark macht, ist das zugrunde liegende Gefühl, dass die Band genau versteht, was unterdrückt oder womit gerechnet werden muss, um es zu singen. “We are three of the most depressed people you could ever come into contact with, depending on the day”, sagt McPherson mit einem Lächeln.
Gavin, McPherson und Josette Maskin – die Gitarristin von MUNA – verbindet eine bald zehnjährige Freundschaft. Sie begannen im College an der USC zusammen Musik zu machen und veröffentlichten 2017 mit der Single „I Know a Place“ einen frühen Hit als eine aufgestaute Beschwörung zur LGBTQ-Zuflucht und Transzendenz. Jetzt, in ihren späten Zwanzigern, ist das Trio so etwas wie eine Familie geworden. Sie verbrachten einen Großteil der frühen Pandemie als eine Gruppe, die füreinander und für MUNA da war – ein Projekt, das sich zu diesem Zeitpunkt größer anfühlt als sie selbst – selbst als sie sich über nix in Bezug auf Zukunft sicher sein konnten.
Sie wurden von ihrem vorigen Label RCA gedroppt und es gab nur wenig Einkommen, kein Adrenalin, mit dem sie arbeiten konnten, keine Live-Shows mit Publikum, das sie an den Beistand erinnerte, den ihre Songs bieten können. Sie fragten sich gegenseitig: Ist diese Karriere in dieser neuen Realität überhaupt machbar? Können wir einen Weg finden, uns selbst zu motivieren und uns selbst zu verwirklichen? Monatelang gaben sie sich dieser Verwirrung hin – dieser Realität, durch Veränderungen gedemütigt zu werden. “You have to let things fall apart”, erklärt Gavin. “And it was only possible because of this tremendous trust. I have so few relationships in my life where I have the kind of trust that I do with Naomi and Jo — where I can trust that there’s a higher purpose, that we can work through all the boundaries and compromises and mess that comes with long-term relationships, and then return to form.”
„Muna“, das selbstbetitelte dritte Album der Band, ist mehr als eine Rückkehr. Die Zeit der Unsicherheit und des offenen Hinterfragens der Band hat alles weggebrannt und ein Meisterwerk von einem Album hinterlassen – die kraftvolle, bewusste, dimensionale Leistung einer Band, die niemandem außer sich selbst etwas beweisen muss. Der Synth auf „What I Want“ funkelt wie eine ROBYN-Tanzflächenhymne; „Anything But Me“, das im 12/8-Takt galoppiert, erinnert an SHANIA TWAIN im Neonlicht der Achtziger; „Kind of Girl“ mit seinem aufsteigenden, klagenden THE CHICKS-Refrain bittet darum, mit deinen besten Freund*innen bei maximaler Lautstärke gesungen zu werden.
MUNA arbeiteten mit dem Quellcode des Pop, der das Herz berührt – das Album ist voller Sehnsucht und Offenbarung und hart erkämpfter Freiheit. Ihr erstes Album hatten sie selbst mit kostenlosen Plug-ins in einem Heimstudio aufgenommen, das zweite in richtigen Sessions mit Co-Produzenten eingespielt, weil sie dachten, sie müssten professioneller werden. Mit MUNA hat die Band es wieder ganz alleine geschafft, mit neu gewonnener kreativer Sicherheit und technischem Können – sowohl in Bezug auf McPhersons und Maskins Arrangements und Produktion als auch durch Gavins Songwriting, das so treibend wie immer ist, hier aber neue Momente der Perspektive und Anmut eröffnet.
“What ultimately keeps us together”, erklärt Maskin, “is knowing that someone’s going to hear each one of these songs and use it to make a change they need in their life. That people are going to feel a kind of catharsis, even if it’s a catharsis that I might never have known myself, because I’m fucked up.” McPherson fügt dem hinzu: “I hope this album helps people connect to each other the way that we, in MUNA, have learned to connect to each other.” Und das ist genau das, was MUNA letztendlich tun: Einen Raum inmitten eines existenziellen Schlamassels schaffen, durch welches man sich tagtäglich durchwurstelt, sodass du dich ganz plötzlich – du, der sich in der Musik auf die Suche nach einer Antwort begibt, die du nirgendwo anders zu finden scheinst – einen Raum findest, in dem alles möglich ist. Ein Raum, in dem die Discokugel nie aufhört, ein Funkeln an die Wände zu werfen, in dem du schwitzen und weinen und dich auf den Boden legen und mit wem auch immer rummachen kannst. Ein Ort, in dem Verletzlichkeit in der Gegenwart derer, die dich lieben, dir das Gefühl geben kann, für einen Moment kugelsicher zu sein, und in dem Selbstbewusstsein die Woge der Freude nur verstärkt.