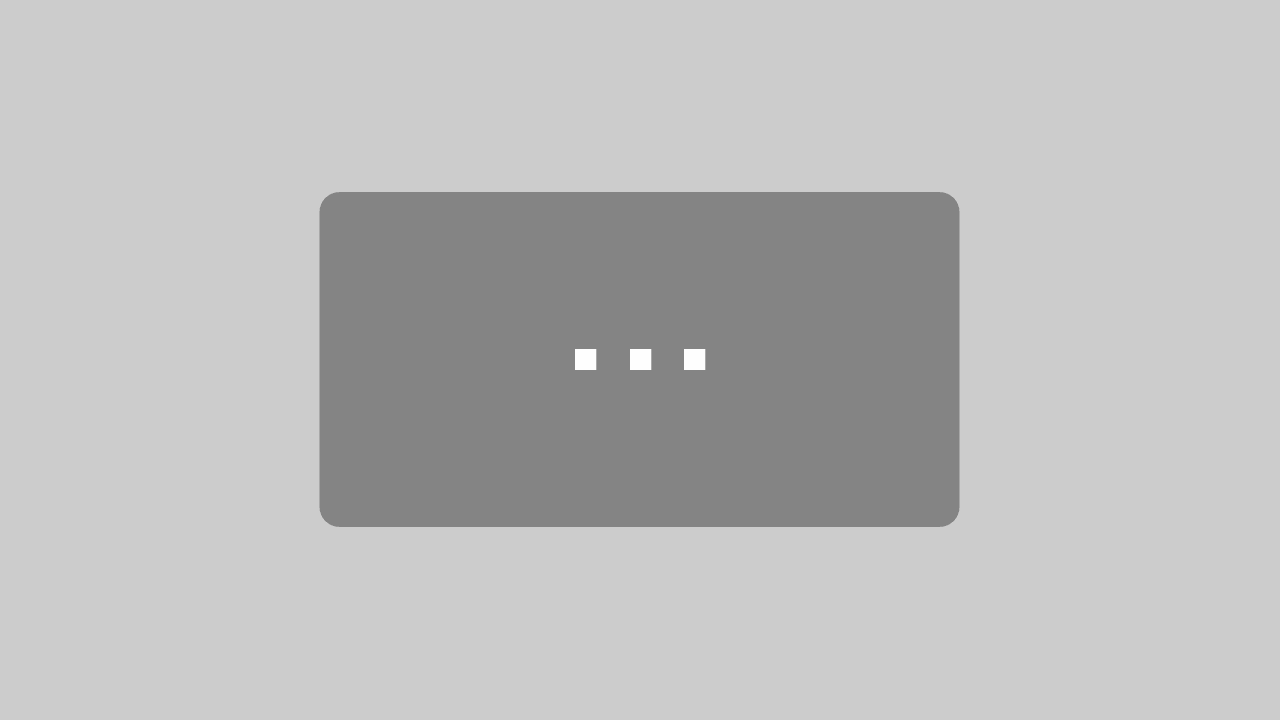Florian Künstler: „Es ist eine der schönsten Sachen, die ich erleben darf“
Das Jahr 2023 kann der Lübecker Singer-Songwriter Florian Künstler wohl als das Jahr seines Durchbruchs in der deutschen Musikszene abspeichern. Zuerst erreichte sein Hit „Kleiner Finger Schwur“ Millionen von Nutzern der Plattformen TikTok und Instagram und dann stiegt sein Debüt-Album „Gegengewicht“ von 0 auf Platz 11 in den deutschen Album Charts ein. Seitdem hat sich im Leben von Florian Künstler so einiges positiv verändert, vor allen Dingen kommen deutlich mehr Menschen zu seinen Konzerten und zeigen sich zutiefst berührt von den emotionalen Texten des charismatischen Sängers. Auch 2024 ist bereit sehr gut gestartet und seine Kollaboration mit Alexander Eder mit dem Titel „Lass dir Zeit mit erwachsen werden“ knackte in kürzester Zeit bereits über eine Millionen Streams allein bei Spotify. Seit April ist Florian Künstler bundesweit auf einer bereits größtenteils ausverkauften Tour durch Deutschland und Österreich und am 1. September hat er musikalische Freunde wie Cassandra Steen oder Laith Al-Deen zu seinem ersten eigenen „Florian Künstler & Friends“ Open Air in Lübeck eingeladen.

Ich durfte Florian kurz vor dem Konzert am 28. April 2024 in der Garage Saarbrücken treffen und erlebte einen sehr sympathischen, gut gelaunten Künstler, der sehr offen auf all unsere Fragen geantwortet hat:
Hallo Florian. Schön, dich zu treffen. Ich hab dich letztes Jahr zweimal live gesehen. Zunächst hier in der Saarlandhalle als Support von Max Giesinger, dann beim Reeperbahn Festival in Hamburg. Jetzt bist du auf großer Solotour. Deine Karriere hat ziemlich schnell Fahrt aufgenommen. Wie war das für dich?
Surreal ist das richtige Wort, glaube ich. Bei Max war es schon sehr beeindruckend, die Größe dieser Halle zu sehen. Da dachte ich „Oha – viele Menschen.“ Jetzt bin ich allein mit meiner Band unterwegs. Das ist sehr schön, aber man realisiert das immer erst später. Ich bin so fokussiert, dass der Abend gut läuft und die Leute Spaß haben. Und wir natürlich auch. Du gehst abends zum Bus, bist morgens in einer anderen Stadt, dann Bühne, Soundcheck und Power. Es ist eine der schönsten Sachen, die ich erleben darf. Allein wenn ich jetzt daran denke, dass gleich so viele Menschen da stehen. Das ist eh komisch, dass Leute kommen, um uns zu sehen. Bei Spotify sehe ich nur Zahlen, aber hier sehe ich Menschen, die mitsingen. Es gibt nichts Schöneres!
Deine Songs bieten sich ja zum Mitsingen an. Beim Reeperbahn Festival habe ich das ziemlich eindrucksvoll erlebt, wie du das Publikum mitgerissen hast.
Hamburg hat meistens Power. Es waren nicht viele, aber es war sehr laut.
Wenn du jetzt am Eingang der Garage schaust: Da sitzen schon seit 15.30 Uhr ein paar Mädels, um nachher in der ersten Reihe zu sein. Einlass ist erst um 19 Uhr.
Ja, krass. Muss ich mal „Hallo“ sagen gehen. Ich bin ja kein Max und kein Johannes, wo man um die Plätze vorn kämpfen muss. Aber es ist gleichzeitig auch schön. Ich hoffe nur, dass sie was Warmes zum Anziehen dabei haben. Ist doch ziemlich kalt heute draußen.

Beim Reeperbahn Festival hast du die “Homeless Gallery” unterstützt – ein Projekt, bei dem Obdachlose mit Hilfe einer KI Bilder erstellt haben. Ich fand es sehr beeindruckend, was da an Kunstwerken geschaffen wurde. Was bedeutet es für dich, solche Projekte zu begleiten?
Ich weiß aus erster Hand, wie sich das wirklich anfühlt, weil ich vorher auf der anderen Seite war. Man wird unsichtbar und ist kein Mitglied der Gesellschaft mehr. Das Projekt hat diese Situation sichtbar gemacht. Gerade Leute, die lange auf der Straße leben, verschließen sich. Nicht jeder kann sich gut ausdrücken. Nun hatten sie die Möglichkeit, mit Hilfe einer KI ihre Gedanken auf ein Bild zu bringen. Man konnte den Stolz von allen spüren, die da waren und einen Teil von sich gezeigt haben. Ich kannte das Gefühl und war froh, die Menschen supporten zu dürfen. Ich habe auch selbst eins der Bilder ersteigert. Wenn das Geld jetzt dabei hilft, dass jemand sich sein Leben wieder ein bisschen aufbauen kann oder die Organisation alles sichtbar machen kann, dann war es gut. Ich hab schon viel gemacht. In Berlin war ich bei der Caritas tätig, in Lübeck hab ich den Wärmebus gefahren.
Machst du das noch selbst?
Ja, im Winter fahre ich oft noch beim Wärmebus mit. Im Sommer hab ich jetzt nicht so viel Zeit wegen der Musik und der Tour, aber im Winter bin ich wieder dabei.
Auf deinem ersten Album erzählst du viele kleine Geschichten, bei denen es oft um schwierige Themen geht – wie Trauer und Depression. So klingen deine Songs manchmal wie kleine Lebensratgeber und Mutmacher. Schöpfst du dabei aus eigenen Erfahrungen?
Ja, das hab ich selbst erlebt. Eine Zeit lang dachte ich, dass ich nie wieder fröhlich werde. Das war ein heftiger Schnitt in meinem Leben – vielleicht der heftigste. Und was Trauer angeht: Ich habe öfter Menschen gehen lassen oder mit Trauerverabeitung umgehen müssen. Jemanden zu verlieren, den man nie wieder sehen wird – das habe ich nicht verstanden. Oder für mich als Pflegekind in verschiedenen Familien aufzuwachsen, das war auch nicht so einfach. Das musste ich in meine Lieder packen und das ist auch ein wenig Heilung für mich. Wenn ich „Tausende mehr“ mit dem Publikum singe, das ist ein Wahnsinnsgefühl. Und danach bekomme ich viele Nachrichten auf Instagram oder werde beim Autogrammeschreiben angesprochen. Dann erzählen mir Menschen, dass sie in Kliniken waren oder sich Hilfe gesucht haben. Jeder Mensch hat bestimmt in seinem Leben eine Phase, wo er denkt, ich sehe mich von außen, ich erkenne mich gar nicht wieder. Die hatte ich auch, aber ich habe das Glück, dass ich darüber singen kann.
Ich denke auch, dass deine Lieder den Menschen helfen können. Dass sie sich verstanden fühlen.
Genau. Ich will immer auch Hoffnung drin haben. Bei „Schwarzer Anzug“ heißt es: „Gib mir ein Zeichen und ich werde es verstehen“. Oder „wenn du jetzt glücklich bist“ in „Tausend Raketen“. Das sind schwere Themen, aber gleichzeitig hoffe ich, dass die Menschen, die nicht mehr da sind, spüren, dass wir an sie denken. Wenn wir auf einem Konzert sind und ich dieses Thema anspreche, sehe ich in den Augen der Menschen, dass sie an einen geliebten Menschen denken, den sie verloren haben. Und diese Person ist dann für drei Minuten – so lange das Lied geht – kurz wieder da. Die Tränen sind nicht unbedingt Traurigkeit, sondern: Es war ein schönes Leben mit dir und ich vermisse dich, aber ich weiß, dass das Leben so ist.
Wenn du das so erzählst, bekomme ich Gänsehaut.
Und ich hab Gänsehaut, wenn ich da im Konzert stehe, wenn die Lichter angehen und wir zusammen singen. Dieses Gefühl, mit Depressionen nicht alleine zu sein, ist so wichtig. Gerade Männer haben Schwierigkeiten, damit umzugehen. Aber dann schaue ich in die Gesichter und weiß: In diesem Augenblick sind wir ganz viele. Man kann das im Moment nicht reparieren, aber es nimmt ein bisschen die Last. Man guckt sich um und denkt: Ach, du auch.
Um wen geht es in „Schwarzer Anzug“?
Um einen guten Freund aus der Schule, der viel zu früh gehen musste. Es war einfach unfair. Da musste ich erstmals mit Trauer umgehen. Vor dem Song erzähle ich bei Konzerten gerne die Geschichte, wie ich auf der Beerdigung stand und sagte: Gib mir ein Zeichen. Und dann ging ein Ruck durch die Bäume, der war richtig heftig. Natürlich kann das Zufall gewesen sein, aber ich dachte: Ja – da ist das Zeichen.
Bei deinen Konzerten hat man das Gefühl, dass du auch einem großen Publikum sehr nahe sein kannst. Hat dir deine Zeit als Straßenmusiker geholfen, eine solche Nähe zu den Menschen aufzubauen?
Ich bin immer sehr aufgeregt, aber ich fühle mich auch wohl. Ich kann nur zeigen, was ich habe. Wenn das jemand gut findet, dann freue ich mich. Man kann es nicht allen recht machen, aber wenn man in einem Riesenpublikum ein paar erreicht, das ist richtig schön. Ich will alles raus geben, was ich habe. Das ist es ja auch, was ich selbst bekommen möchte – etwas Unverpacktes. Aber ich bin total nervös und mache mir so richtig in die Hose da vorne. Die Straßenmusik hilft mir da schon. Überhaupt dass ich die Shows so durchhalte. Fünf Shows hintereinander – da hilft mir die Straßenmusik sehr. Ich musste laut singen und mir Aufmerksamkeit erkämpfen. Auf der Straße war ich auch immer sehr aufgeregt. Man fängt vor nichts an zu singen, stört vielleicht die Leute, die da arbeiten.
Und wenn keiner stehen bleibt, hast du verloren.
Ja, damit musst du auch umgehen. Das ist ganz schön heftig. Aber da lernst du ganz gut, dass nicht jeder die gleiche Musik hört. Nicht jeder hat Zeit oder manche sind mit eigenen Problemen beschäftigt. Dann schau ich mir die Leute im Publikum an. Gestern war da eine Frau, die die ganze Zeit so böse geguckt hat. Und ich dachte: Oh, der gefällt es wohl gar nicht. Ich sehe sowas immer während der Konzerte. Und zum Schluss kam sie zu mir und meinte: „Das war das schönste Konzert ever. Ich war so berührt.“ Ich hab es nicht verstanden, aber man kann halt nicht in die Menschen rein schauen. Man sollte sich nicht verrückt machen, aber jeder Sänger macht sich verrückt. Wenn jemand an der falschen Stelle lacht oder hustet. Die Unsicherheit ist oft so groß, aber wenn es nicht so wäre, wäre es noch falscher.
Du hast viele soziale Ämter, in denen du tätig bist. Sind das alles Ehrenämter oder hast du auch einen sozialen Beruf erlernt?
Ich habe Rettungsassistent gelernt, bin Krankenwagen gefahren. Dann habe ich in einer Schule als Schulbegleiter mit Kindern mit Autismus gearbeitet. Ich habe jede Menge Jobs gemacht und es waren immer die sozialen. Ich mochte es, mit Menschen zu arbeiten, habe gern die Geschichten gehört. Wollte wissen, was in den Köpfen so los ist. Da ich selbst Pflegekind war, wusste ich, wie es den Kindern so geht. Dass sie es in der Schule nicht so leicht haben. Ich war mehr so ein Freund und es war für die meisten sehr cool, einen größeren Freund zu haben. Es gibt nicht traurigeres als ein Kind, dass allein auf dem Schulhof sitzt und mit dem keiner was zu tun haben will. Dann haben andere Kinder mich gefragt: „Warum bist du denn hier?“ Und ich habe erklärt, dass das eine Kind vielleicht etwas ruhiger ist und warum. So hat man über Autismus gesprochen, ohne das medizinisch darzulegen. Wenn diese Kinder danach etwas mehr in die Gemeinschaft eingebunden wurden, hat mich das sehr gefreut.
Ich kann das gut nachvollziehen, da ich selbst im Hauptberuf als Sozialpädagoge mit beeinträchtigten Menschen arbeite.
Ach ja, cool. Dann kennst du das ja. Manchmal dauert es recht lange, bis man Erfolge sieht, aber wenn sie da sind, ist es echt krass.

Natürlich gibt es nicht nur problembeladene Songs von dir, sondern auch positive und lustige Anekdoten wie das humorvolle “Gegengewicht” oder „Magnet“. Magst du auch dazu was erzählen?
Richtig. „Vergiss die Guten Tage nicht“ oder „Marie“ – das sind ja nicht nur traurige Sachen. Ein Konzert sollte immer beides haben: Nachdenkliches und Hoffnung. Und ein bisschen tanzen. Wir haben auch ein paar Dance-Sachen drin. Dieses Potpourri macht ein Konzert für mich aus. Man taucht kurz in etwas Schweres ein, wird aber auch wieder rausgeholt. Manchmal ist es witzig, manchmal auch ungewollt witzig. Dann gibt es Momente, wo wir einfach zusammen laut singen, grölen, abtanzen. Ich mag meine Band sehr und die haben echt Bock zu spielen.
Wie geht es weiter? Wird es bald ein zweites Album von dir geben oder ist das noch weit weg?
Ich denke, Anfang des nächsten Jahres. Ich schreibe schon und das Schwere wird sein, aus der Vielzahl an Songs die Songs fürs Album auszuwählen. Ich habe so viel geschrieben, dass es wohl ein schwieriger Prozess wird. Es sind bestimmt dreißig Songs, und davon muss ich dann 12-13 auswählen. Ich werde ohnehin viele raus bringen bis dahin und ein paar werden auf dem Album sein, aber die Leute sollen auch nicht alles schon kennen, wenn das Album erscheint.
Genau. Ein paar Überraschungen müssen dabei sein. Was dürfen wir denn vom heutigen und von weiteren Konzerten der aktuellen Tour erwarten? Wird es schon neue Songs geben? Singst du auch Coverversionen?
Wir haben eine neue Nummer mit deutschem Text auf die Melodie von „Time After Time“. Da müssen wir noch auf die Freigabe der Rechte warten, um das rauszubringen. Aber echte Coverversionen nicht. Ich hab das schon gesehen – bei Wincent und Johannes -, aber da musst du stabiler sein, um das machen zu können. Max lässt ja manchmal die Leute raussuchen, welcher Song gespielt wird. Das klappt total gut und lockert die Stimmung. Manchmal ist es „Highway To Hell“ oder sowas. Man braucht auf jeden Fall eine gute Band. Von meiner Zeit auf der Straße hätte ich noch ein paar Cover.
In Lübeck wird es Anfang September ein Konzert “Florian Künstler & Friends” geben. Cassandra Steen, Alexander Eder, Laith Al-Deen und Madeline Juno sind mit dabei. Wie kam es dazu? Was verbindet dich mit diesen Künstler*innen?
Freundschaften! Es ist ja verrückt, dass du mit der Zeit deine Idole triffst. Die meisten kennen sich untereinander. Mit Laith habe ich Songs geschrieben für sein neues Album. Mit Cassandra, Maddie und Alex hab ich Duette. Zuerst gab es die Freundschaften und daraus sind die Duette gewachsen. Deshalb heißt es ja „Florian Künstler & Friends“ und ich dachte, wen lade ich ein? Es ist sonntags in Lübeck, wird riesengroß und ich hoffe, dass viele Menschen kommen.
Dann wünsche ich dir viel Glück und erfolgreiche Konzerte. Vielen Dank für deine Zeit und das Interview!
Herzlichen Dank an Daniela von der Promotion-Werft für die Vermittlung des Interviews.
Das Konzert war ebenso bewegend wie das Interview. Zunächst war die wundervolle revelle als Support allein am Klavier und gab ihre emotionalen Songs zum Besten. Dann startete Florian mit Band und sattem Sound voll durch. Allerdings hatte er fast immer auch selbst eine Gitarre in Händen und war bei Stücken wie „1000 Raketen“ und „Du bist nicht allein“ solo auf der Bühne.
in 110 Minuten Konzertlänge mit zwei Zugaben erzählte Florian aus seinem bewegten Leben und vom Fanmoment mit Cassandra Steen. „Wovor hast du Angst?“ glänzte mit einem tanzbaren Sound – und dann gab es Mitsingparts wie bei „Luke und Lorelei“. Er sprach offen über seine Pflegefamilie und die verstorbenen Großeltern. Trotzdem gab es mit „Vergiss die guten Tage nicht“ dazu einen positiven Song.
Der Abend in der Garage hat viele Menschen bewegt – und wer nicht genug bekommen hat, kann Florian Künstler schon bald wieder als Support von Max Giesinger in Trier sehen: am 20.6.2024 vor der Porta Nigra!
Hier die aktuellen Tourdaten für 2024 und 2025:
- 30.04.24 Freiburg, Jazzhaus
- 01.05.24 Ulm, Roxy
- 02.05.24 Wien, B72
- 03.05.24 Leipzig, Werk 2
- 04.05.24 Dresden, Alter Schlachthof
- 01.09.24 Lübeck, Kulturwerft Gollan Open Air „Florian Künstler & Friends“
„Du bist nicht allein“ Tour 2025
- 20.03.25 Osnabrück
- 21.03.25 Dortmund
- 22.03.25 Aurich
- 23.03.25 Hannover
- 26.03.25 Köln
- 27.03.25 Stuttgart
- 28.03.25 Mannheim
- 29.03.25 München
- 30.03.25 Frankfurt
- 01.04.25 Erlangen
- 02.04.25 Leipzig
- 03.04.25 Dresden
- 04.04.25 Berlin
- 05.04.25 Magdeburg